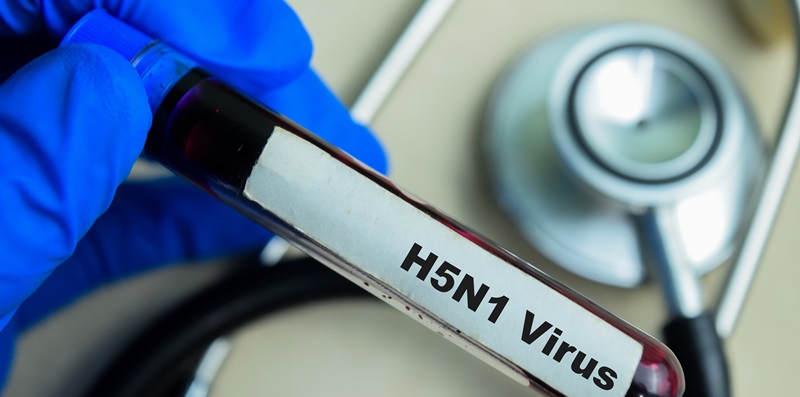BfR-Software führt schnell zur Quelle eines lebensmittelbedingten Krankheitsausbruchs
Kontaminierte Lebensmittel führen jedes Jahr bei Millionen Menschen weltweit zu teils schwerwiegenden Erkrankungen. Um schnell handeln zu können, ist es von großer Bedeutung, den Ursprung der Verunreinigung herauszufinden. Bereits vor ca. 13 Jahren hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) den bakterienbedingten EHEC-Ausbruch zum Anlass genommen, eine Software zur Rückverfolgung von Warenketten zu entwickeln. Die frei verfügbare Open-Source-Software FoodChain-Lab wurde seitdem fortlaufend weiterentwickelt und wird unter anderem von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für die eigene Arbeit genutzt.
„Bei einem lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch muss die Quelle rasch gefunden werden“, erklärt BfR-Präsident Andreas Hensel. „Daher freuen wir uns, dass unsere Software auch von anderen internationalen Lebensmittelbehörden zur Problemlösung genutzt wird – denn Lebensmittelsicherheit ist eine globale Herausforderung.“
Durch interaktive Analysen schätzt die Software für jedes Produkt und jede Station, wie wahrscheinlich sie mit einem Ausbruchsgeschehen verknüpft sind. Das Programm simuliert zudem die Übertragung von Krankheitserregern (Kreuzkontamination) während der Herstellung oder Verarbeitung eines Produkts sowie mögliche geografische Zusammenhänge.
Verbote von Lebendtiertransporten werden lauter
Am 14. Juni wird jedes Jahr der Internationale Tag gegen Tiertransporte begangen. An diesem Tag finden weltweit zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen statt, die auf Lebendtiertransporte und deren teils massive Folgen für die Tiere aufmerksam machen. Der Deutsche Tierschutzbund forderte aus diesem Anlass am vergangenen Freitag (14.06.2024) ein generelles Verbot von Tiertransporten außerhalb Europas und nimmt dabei auch das neue EU-Parlament in die Pflicht. „Der barbarische Handel mit lebenden Tieren rund um den Globus muss beendet werden. Deutschland darf sich nicht weiter hinter der EU verstecken, um die eigene Untätigkeit zu verschleiern, sondern sollte eine Vorreiterrolle übernehmen“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.
Auch die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN nahm den Tag zum Anlass, auf die Missstände einiger Transporte hinzuweisen. „Nicht nur an einem Tag wie diesem werden wir weiter unermüdlich gegen grausame Tiertransporte kämpfen. Gegen Transporte, bei denen die Tiere leiden: unter Wassermangel, Hitze, Kälte, Stress, Infektionen und mangelnder Hygiene. Es gibt im Jahr 2024 keinen vernünftigen Grund, fühlenden Lebewesen diese Torturen zuzumuten. Doch solange bei diesen schmutzigen Geschäften der Rubel rollt, rollen auch weiter die Lkw. Die grausame Praxis von Transporten auf den Straßen und auf dem Seeweg muss endlich beendet werden“, erklärte Nadine Miesterek, Campaignerin für Tiertransporte bei VIER PFOTEN.
Wie der Deutsche Tierschutzbund erklärt, hatte das EU-Parlament zwar Verbesserungen versprochen, aber mit dem 2023 publik gemachten Verordnungsentwurf die Chance verpasst, auf einen reinen Handel mit Fleisch bzw. Schlachtkörpern umzusteigen. Stattdessen wurden lediglich schwache Änderungen bei den Transportvorschriften angekündigt.
EU wappnet sich für möglichen H5N1-Ausbruch
Um die Ausbreitung sowie potenzielle Ausbrüche der Aviären Influenza (AI) in Europa zu verhindern, hat die EU-Kommission 665.000 Impfstoffdosen erworben. Die Behörde für Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) hat im Namen von fünfzehn Mitgliedsstaaten einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Zudem erhält die Behörde die Option auf den Erwerb von 40 Millionen Impfdosen in den nächsten vier Jahren. „HERA zeigt wieder einmal die Europäische Gesundheitsunion in Aktion, indem sie dafür sorgt, dass wir vorbereitet sind", sagte ein Sprecher der Kommission auf einer Pressekonferenz in Brüssel.
Die Behörde weist jedoch erneut darauf hin, dass es bislang zu keiner H5N1-Übertragung von Mensch zu Mensch gekommen sei. Ein sehr geringes Infektionsrisiko besteht aktuell lediglich für Menschen, die engen Kontakt zu infizierten Tieren haben und sich in kontaminierten Räumen aufhalten. Daher sei der Impfstoff nur für Personenkreise mit einer besonders hohen Exposition gegenüber der potenziellen Übertragung der AI durch Vögel oder andere Tiere bestimmt, erklärt die EU-Kommission.
„Auch wenn von der Vogelgrippe nach wie vor nur eine geringe Gefahr für die allgemeine Bevölkerung ausgeht, müssen wir besonders gefährdete Menschen wie Personal von Geflügelfarmen oder bestimmte Tierärztinnen und Tierärzte schützen“, betont Stella Kyriakides, Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
Erster ASP-Fall in Hessen
In Hessen ist der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) aufgetreten. Ein totes Wildschwein, das südlich von Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) nahe einer Landstraße gefunden worden war, wurde positiv auf das Virus getestet, was am vergangenen Samstag (15.06.2024) bereits durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigt wurde. Zwei weitere tote Wildschweine waren nicht mit dem ASP-Erreger infiziert.
Um eine weitere Verbreitung zu vermeiden, arbeiten der Kreis Groß-Gerau, das Regierungspräsidium Darmstadt und das hessische Landwirtschaftsministerium eng zusammen. In einem Radius von zirka 15 Kilometern ist eine Restriktionszone eingerichtet worden. Das epidemiologische Expertenteam des FLI wird die Veterinärbehörde des Landkreises Groß-Gerau vor Ort unterstützen und beraten. Jäger und Drohnen suchen zudem das Gebiet um die Fundstalle großflächig nach eventuell weiteren toten Tieren ab.
Schweinebestände in NRW nehmen weiter ab
In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Schweine weiter gesunken. Das ergab die Auswertung der repräsentativen Schweinezählung, die das Institut Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt veröffentlicht hat.
Demnach gab es zum Stichtag am 3. Mai 2024 noch 5,77 Millionen Schweine. Das entspricht einem Minus von 1,4 Prozent gegenüber der Zählung am 3. November 2023. Zudem wurden rund 5.270 Betriebe mit einem Mindestbestand von 50 Schweinen oder zehn Zuchtsauen gezählt. Während sich die Zahl der Ferkel (-4,7%) sowie der Zuchtschweine über 50 Kilogramm (-0,6%) und Jungschweine unter 50 Kilogramm Lebendgewicht (-1,7 %) verringert hat, wuchs der Bestand der der Mastschweine um 0,7 Prozent auf 2,78 Millionen Tiere. Diese machten annähernd die Hälfte des Gesamtschweinebestandes in NRW aus.
Im Zehnjahresvergleich ist die Zahl der Betriebe mit Schweinehaltung in NRW um 34,4 Prozent zurückgegangen, die Zahl der Tiere ist im selben Zeitraum um 21,8 Prozent gesunken.
Tierschutznovelle: DBV fordert Nachbesserungen
Am kommenden Montag wird sich der Bundesratsausschuss mit dem Entwurf der Novelle des Tierschutzgesetzes befassen. Der Deutsche Bauernverband (DBV) kritisiert den Gesetzesentwurf der Bundesregierung scharf und erwartet ein deutliches Signal vom Bundesrat.
„Der vorgelegte Gesetzentwurf enthält praxisferne und nicht praktikable Regelungen und Verbote, die dringend nachgebessert werden müssen! Vor allem die Vorgaben zur Schweinehaltung führen zu weniger Tierschutz und zu mehr Bürokratie“, erklärt DBV-Präsident Joachim Rukwied. „Die Tierhalter sind bereit zur Weiterentwicklung des Tierwohls und des Tierschutzes. Dazu brauchen sie aber praktikable Regelungen im europäischen Gleichklang und keine nationalen Alleingänge, die nur die Verlagerung der Tierhaltung ins Ausland zum Ziel haben.“
Jürgen Langreder vom Vorstand des Bundesverbandes Rind und Schwein (BRS) kritisiert unter anderem die zusehends ideologisch getriebene Förderpolitik der Ampelkoalition. In 90 Prozent der Schweine haltenden Betriebe in Deutschland würden die Tiere in den Haltungsstufen 1 und 2 aufgezogen. Diese Betriebe haben bislang jedoch keine Möglichkeit, Fördermittel zu erhalten. Dabei ließe sich auch hier mehr Tierwohl umsetzen, so Langreder. Er fordert auch für diese Haltungsformen entsprechend Förderungen. Genauso unverständlich sei für ihn, dass sowohl das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) als auch die Ringelschwanzprämie in Niedersachsen gestrichen werden sollen, mit dem Argument, dass eine Doppelförderung ausgeschlossen werden müsse. Dabei sei gerade die Ringelschwanzprämie eine Erfolgsgeschichte.
Mit den aktuellen Problemen des Tierschutzes befasst sich auch die schon traditionelle Tierschutztagung, die am 12. und 13. September 2024 sowohl als Präsenz- als auch als Online-Veranstaltung stattfinden wird. Die Tagung richtet sich an Amtstierärzt:innen und kurativ tätige Tierärzt:innen, sowie an Studierende der Veterinärmedizin und Veterinärreferendar:innen. Die Anmeldung ist bis 10. September um 16 Uhr möglich.
Angst vor erneuter Umweltkatastrophe in der Oder wächst
Im Sommer 2022 fand in der Oder, die zum Teil Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen ist, ein massenhaftes Fischsterben statt. Der Grund für diese ökologische Katastrophe war ein zu hoher Salzgehalt, der das Ausbreiten der giftigen Goldalge (Prymnesium parvum) nach sich zog. Nach Informationen des brandenburgischen Landwirtschaftsministeriums besteht seit einigen Tagen erneut eine hohe Algenkonzentration. Die Goldalge hat sich laut Ministerium mittlerweile im gesamten Flusslauf einschließlich der Nebengewässer etabliert. Auch wurden vereinzelt tote Fische gesichtet. Das Brandenburger Umweltressort berät aktuell über die Situation im Grenzfluss.
Trotz steigender Wasserstände am vergangenen Wochenende bleibt die Gefährdungsstufe 3, die höchste Warnstufe, bestehen, lässt das Amt verlauten. Durch die Katastrophe vor 2 Jahren sei das Flusssystem noch instabil, da die Algen fressenden „Filtrierer“, wie Schnecken und Muscheln größtenteils noch fehlen und sich das Ökosystem noch nicht erholen konnte. So bleiben die Messwerte zur elektrischen Leitfähigkeit mit zirka 2000 Mikrosiemens pro Zentimeter sowie der Chlorophyllgehalt mit rund 250 Mikrogramm pro Liter sehr hoch.
Das Landesamt für Umwelt führe das Monitoring fort, heißt es weiter. Landkreise, die Nationalparkverwaltung, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie das Bundesumweltministerium würden fortlaufend über die Entwicklungen informiert. Zudem konnte der Austausch zwischen den Expert:innen des Brandenburger Landesamts für Umwelt und ihren polnischen Kolleg:innen intensiviert werden.
„Wie oft muss sich das Fischsterben an der Oder noch wiederholen, bevor endlich gehandelt wird?“, fragt NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger. „Der Fluss braucht jetzt eine umfassende Erholung und Renaturierung, um ihn resilienter zu machen. Sonst werden wir jedes Jahr eine Katastrophe zu beklagen haben. Der Oderausbau muss sofort gestoppt werden, damit sich das Ökosystem erholen kann.“
Aufzucht ist Basis für resistente Milchkühe
Schon in den ersten Tagen nach der Geburt kann der Grundstein für ein gesundes und langes Leben von Milchkühen gelegt werden. Eine Studie der Landesforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern mit 27.664 Erstlingskühen hat ergeben, dass die Menge der gefütterten Milch bzw. der Milchaustauscher entscheidend für die tägliche Zunahme der Kälber sowie die weitere Lebensleistung ist. Die Untersuchung bestätigte auch, dass so gefütterte Kälber als Kühe eine deutlich geringere Abgangswahrscheinlichkeit in der ersten Laktation hatten. Diese Kühe blieben zudem länger im Betrieb und erreichten eine höhere Lebensleistung.
Die Grundlagen für die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit einer Kuh werden in den ersten Lebenstagen und -wochen des Kalbes gelegt und hier vor allem mit der Fütterung und mit der Tränke. Intensiv getränkte und satte Kälber sind auch weniger krankheitsanfällig. Denn es zeigte sich, dass Kälber, die höhere Milchmengen erhalten, auch mehr Zellen in ihren Organen aus, etwa im Eutergewebe. Das ist nach Meinung der Wissenschaftler:innen auch von der Dauer der Tränkephase abhängig, die mindestens 90 bis 100 Tage dauern sollte, wie auch eine Studie der Uni Höhenheim ergeben hat. Hier zeigten sich bei Kälbern, die nach sieben Wochen abgesetzt wurden, zu niedrige Glucose- und Insulinspiegel. Diese Kälber litten häufiger unter einer subklinischen Pansenazidose und waren anfälliger für Krankheiten. Währenddessen wiesen die Kälber, die 17 Wochen Milch trinken durften, nicht nur höhere Glucose- und Insulinspiegel im Blut auf, sondern zusätzlich bessere Leptinwerte.
Bienenverluste lagen bei rund 15 Prozent
Milde Winter, Parasiten und Nahrungsknappheit verursachen jedes Jahr größere Verluste von Bienenvölkern in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Noch bis zur Jahrtausendwende galten Verluste in Höhe von 10 Prozent als normal, seit dem Jahr 2000 jedoch häufen sich höhere Verlustraten und schwankten von Jahr zu Jahr auf hohem Niveau. Nach Auswertung der jährlichen Umfrage der Schweizer Bienenzüchtervereine Apisuisse lag die Verlustrate im letzten Winter in der Schweiz und in Liechtenstein bei 15 %. Die Varroa-Milbe sei hauptsächlich für die Verluste verantwortlich, heißt es in einer Erklärung von Apisuisse. Auch die Nahrungsknappheit einschließlich der fehlenden Blütenvielfalt in vielen Regionen sorge zusätzlich für schwache Bienenvölker.
In Deutschland haben rund 16 Prozent der Bienenvölker den vergangenen Winter nicht überlebt. Das ergab die Analyse der jährlichen Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei Mayen unter mehr als 9.000 Imker:innen bundesweit. Insgesamt mussten mehr als die Hälfte aller befragten Imker:innen Verluste an mindestens einem Bienenvolk hinnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass der vergangene Winter zu etwas mehr Verlusten geführt hat. Im Winter 2022/2023 lag die Ausfallrate nur bei 13,2 Prozent.
Um die Gesundheit und die Haltung von Bienen geht es auch in der dreiteiligen E-Learningreihe Grundkurs Bienen, die Tierärzt:innen auf Myvetlearn.de zur Verfügung steht. Die Kursreihe ist geeignet zur Weiterbildung für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Bienen/den Fachtierarzt für Bienen.
Nachschulung für Sachkundenachweis zur Isofluran-Narkose nicht vergessen
Seit dem 1. Januar 2021 ist die betäubungslose Ferkelkastration verboten. Volljährige Landwirt:innen dürfen ihre Ferkel unter Isofluran-Narkose kastrieren. Der Erwerb eines Sachkundenachweises ist jedoch vorher verpflichtend. Gemäß § 6 Abs. 5 Ferkelbetäubungssachkundeverordnung (FerkBetSachkV) sind die Sachkundeinhaber:innen auch dazu verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab der erstmaligen Ausstellung eines Sachkundenachweises an einer mindestens zweistündigen Fortbildungsschulung teilzunehmen, in der der aktuelle Wissensstand vermittelt wird. Dabei werden die praktischen Fähigkeiten bei der Durchführung der Narkose von einer Tierärztin oder einem Tierarzt überprüft.
Zahlreiche Ferkelerzeuger in Deutschland, die erst seit 2021 haben, sollten daher rechtzeitig an die Nachschulung denken. Entsprechende Informationen bzw. Schulungstermine sind bei den zuständigen Veterinärämtern zu erfragen.